Sämlinge von Tanne und Eiche könnten von abgestorbenem Holz profitieren
Hilft Totholz bei der Etablierung und Entwicklung von gesäten Eichen und Tannen? Ist eine Bodenbearbeitung für die Aussaat überhaupt möglich, wenn das Totholz auf der Fläche verbleibt? Diesen Fragen widmen sich Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena in gemeinschaftlicher Arbeit mit der Stadt Hildburghausen in Thüringen. Das Gemeinschaftsvorhaben wird gefördert durch die Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).
Im Waldklimafonds-Projekt „IntegSaat“ entwickeln Wissenschaftler der Universität Jena ein Konzept zur Integration von Totholz in Verfahren der Saat von Weißtanne und Stiel-Eiche. Auf Dauerbeobachtungsflächen des Stadtwaldes Hildburghausen soll der Effekt des verbliebenen Totholzes auf die Entwicklung der Saat, das Mikroklima, den Boden und die Pflanzendiversität quantifiziert werden. Weiterhin verspricht die Integration von Totholz einen zusätzlichen Schutz der Sämlinge vor Wildverbiss.
Zudem wird in dem Vorhaben der Einsatz von Kleinraupen als Zugmaschine für den Streifenpflug bzw. die Saatmaschine auf Waldumbauflächen mit Totholz erstmals getestet. Arbeitstechnische Handhabung sowie bodenökologische und ökonomische Aspekte werden bewertet und mit den Erfahrungen aus dem Einsatz von Zugpferden verglichen. Das auf der Fläche verbliebene Totholz stellt eine hohe physische Belastung für Zugpferde dar, weshalb ein alternatives Zugmittel erforderlich ist.
Hilfestellung für eine erfolgreiche Direktsaat
Ein weiteres Ziel des Projektes ist es, aus den Ergebnissen standortspezifische waldbauliche Handlungsempfehlungen zur Direktsaat von Stiel-Eiche und Weißtanne abzuleiten, bei denen boden- und naturschutzfachliche Faktoren berücksichtigt werden. Im Gegensatz zur Pflanzung entwickelt sich die Wurzel gesäter Waldbäume ungehindert und störungsfrei, so dass Wasser- und Nährstoffvorräte in tieferen Bodenschichten und auf schwierigeren Standorten besser ausgeschöpft werden können. In der Praxis wird angesichts geringer Kenntnisse der technischen Umsetzung sowie der ökologischen Bedingungen (z. B. Humusgehalt, Luftfeuchte, Temperatur und Bodenvegetationszustand) bisher nur selten auf das Saat-Verfahren zurückgegriffen.
Das auf dreieinhalb Jahre angelegte Projekt startete am 1.11.2021. Die Saat von Weißtanne und Stiel-Eiche wird jeweils im Winter 2021 und 2022 auf zwölf Flächen von insgesamt 24 Hektar Größe vorgenommen.
Hintergrund:
Eine Erhöhung des Totholzanteils in Wäldern wird aus Biodiversitäts- und Klimaschutzgründen von der Forstpraxis angestrebt. Bei bisherigen Verfahren zur Saat von Waldbäumen wurde das Totholz zur Vorbereitung der Flächen auf den Rückgassen abgelegt.
Für den Waldumbau in Richtung klimastabiler Wälder bietet sich auf einem breiten Spektrum an Standorten eine Mischung mit Eichen und mit Weißtanne an. Die Weißtanne ist ein waldökologischer und holztechnologischer sinnvoller Ersatz für die Fichte und gut als Mischbaumart geeignet.
Bei der Weißtanne und den Eichenarten ist eine Einbringung über Naturverjüngung aufgrund von kaum vorhandenen Mutterbäumen in Gebieten mit Fichtenmonokulturen nicht möglich. Zudem wird eine Etablierung durch Wildverbiss häufig stark begrenzt.
Die FNR ist seit 1993 als Projektträger des BMEL für das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe aktiv. Sie unterstützt als Projektträger auch Vorhaben der Förderrichtlinie Waldklimafonds von BMEL und BMU.
Totholz
Als „Totholz“ werden stehende und liegende Bäume oder Teile davon bezeichnet, die abgestorben sind. Das Strukturelement Totholz ist ein wichtiges Biotop für zahlreiche Tier-, Pilz- und Pflanzenarten und trägt als kurzfristiger Kohlenstoffspeicher zum Klimaschutz bei. Beim Zersetzungsprozess werden der gespeicherte Kohlenstoff und Nährstoffe wieder freigesetzt. Ein Teil des Totholzes trägt mittelfristig zum Humusaufbau der Mineralböden bei. Totholz kann sich günstig auf das Mikroklima in Waldbeständen auswirken.
Vorhaben:
Integration von Totholz in Verfahren der Direktsaat von Weißtanne (Abies alba) und Stiel-Eiche (Quercus robur) zur Begründung stabiler, klimatoleranter Mischwaldökosysteme im Stadtwald Hildburghausen (IntegSaat)
https://www.waldklimafonds.de/index.php?id=13913&fkz=2220WK65X4
Fachlicher Ansprechpartner:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Benedikt Wilhelm
Tel.: +49 3843 6930-342
Mail: b.wilhelm(bei)fnr.de
Pressekontakt:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Martina Plothe
Tel.: +49 3843 6930-311
Mail: m.plothe(bei)fnr.de
Das könnte Dir auch gefallen
"Das könnte Dir auch gefallen" general.skip
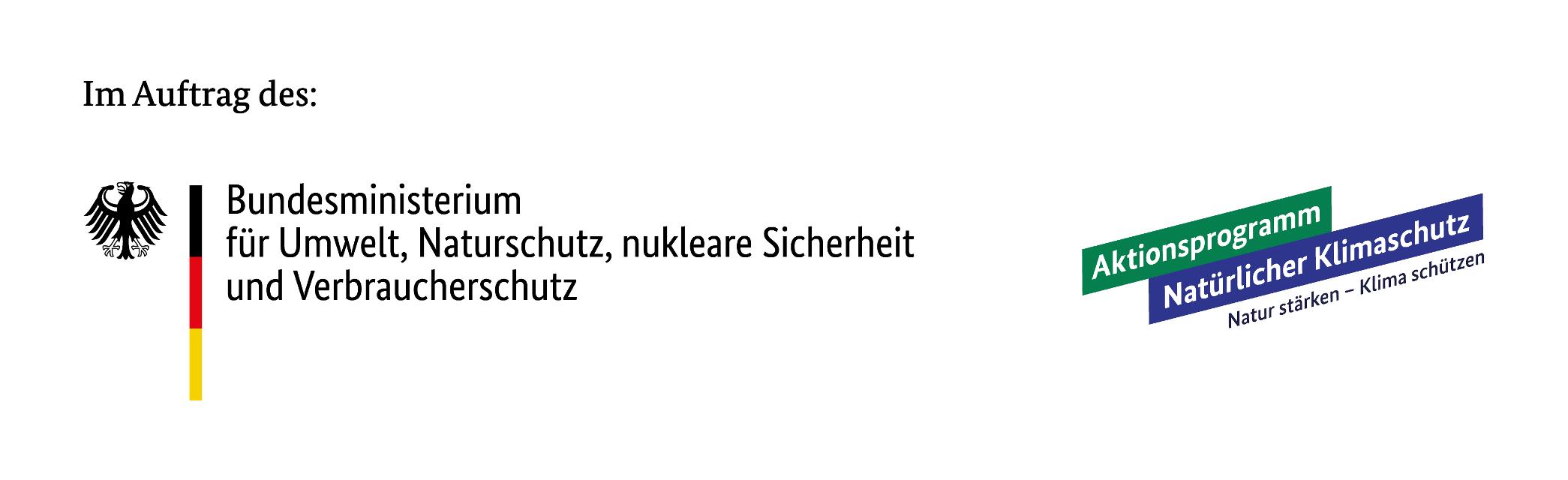
veröffentlicht am 29.04.2024
BMUV und BMEL führen erfolgreiches Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ fort

erstellt am 19.09.2022
Blätter mit herbstlicher Färbung im August, immer mehr absterbende Bäume im Wald und eine Ausbreitung des Borkenkäfers - Diese Anzeichen sind den Meisten wohl dieses Jahr aufgefallen, wenn sie im Wald unterwegs waren. Und die Prognosen sind beängstigend; den voranschreitenden Klimawandel kann der Wald, so wie wir ihn heute kennen, wahrscheinlich nicht überleben.

NES49, 97494 Bundorf
erstellt am 02.03.2022
Gemeinsame Aktion der Bayerischen Staatsforsten Bad Königshofen und des Naturparks Haßberge

Ebene, 96126 Maroldsweisach
erstellt am 16.05.2023
Maroldsweisach - Wanderer im beliebten Naturpark Haßberge können sich über ein neues Schmuckstück freuen: in Altenstein, einem idyllischen Ortsteil von Maroldsweisach, wurde eine moderne, überdachte Sitzgruppe errichtet.

Gemeindewald, 97528 Sulzdorf a. d. L.
erstellt am 27.03.2023
Gemeinsam mit der Försterin Julia Bischof vom AELF hat der Naturpark Haßberge auf einer Waldfläche der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. ein Feuchtbiotop angelegt.

veröffentlicht am 18.02.2022
Anna-Lena Kröckel lebt in Gelnhausen und arbeitet für ODW Elektrik in Steinau. Das international im Automotive Bereich tätige Unternehmen verfügt auch über einen Standort in Mexiko, dort lebte die Botschafterin eineinhalb Jahre. Zurück in Gelnhausen kann sie aus ihrem Homeoffice mit den weltweiten Standorten von ODW kommunizieren und gleichzeitig die Vorzüge des Main-Kinzig-Kreis genießen.

veröffentlicht am 08.12.2021
Das Hotel Birkenhof in Steinheim gilt als Besonderheit in der Stadt Hanau sowie in der Destination Spessart: Darf es als einziges Haus in der Destination weiterhin die Vier Hotelsterne mit dem Zusatz Superior des Deutschen Hotellerie und Gaststättenverbandes (DEHOGA) tragen. Der DEHOGA vergibt die Sterne alle drei Jahre nach erfolgter Prüfung anhand eines festgelegten Kriterienkatalogs.

veröffentlicht am 22.11.2021
Die G-Klassifizierung des Deutschen Hotellerie und Gaststättenverbandes (DEHOGA) ist auf die besonderen Bedürfnisse von Gästehäusern, Gasthöfe und Pensionen ausgelegt. Und so wurde in diesem Herbst auch das Gasthaus „Zum Jossatal“ erneut im Rahmen der G-Klassifizierung vom DEHOGA geprüft und mit drei Sternen ausgezeichnet

veröffentlicht am 23.09.2024
Kunst in der Natur radelnd entdecken ist die Idee des bereits 2017 gestarteten Projektes „Kunstbegegnungen am Kanal“.

veröffentlicht am 15.10.2021
2012 erhielt das familiengeführte Hotel zum Schwanen in Bruchköbel-Roßdorf erstmals die Drei Hotelsterne des Deutschen Hotellerie und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Im Sommer 2021 erfolgte die aktuelle Prüfung durch den DEHOGA, welcher das Haus erneut mit Drei Sternen Superior auszeichnete.

veröffentlicht am 03.01.2022
Knapp 14 Jahre vermietet Ruth Schneider nun schon ihre Ferienwohnungen in Gelnhausen an Geschäftsreisende wie Privaturlauber. In diesem Jahr wurden die beiden Ferienwohnungen „Rottgarten“ erneut mit den Sternen des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) für Ferienunterkünfte ausgezeichnet.


veröffentlicht am 16.03.2023

veröffentlicht am 01.02.2023

veröffentlicht am 10.12.2021
Auch in diesem Jahr werben die Tourismusorganisationen Spessart Tourismus und Marketing GmbH und der Tourismusverband Spessart-Mainland e.V. während der Adventszeit mit einer gemeinsamen Aktion.

veröffentlicht am 22.03.2022
Übernachtungsplus von 8 % - Aufenthaltsdauer auf fast 5 Tage verlängert Die Tourismuszahlen im Jahr 2021 im Main-Kinzig-Kreis sind trotz der Corona-Einschränkungen und den Lockdowns von Januar-Mai im Vergleich zu 2020 gestiegen: um 8,0 % bei den Übernachtungen auf 958.810 und um 4,2% bei den Gästeankünften auf 194.276. Die Aufenthaltsdauer verlängert sich nach dem starken Anstieg im vergangenen Jahr auf jetzt 4,9 Tage (2020: 4,8 und 2019: 3,8 Tage).

veröffentlicht am 18.01.2024

veröffentlicht am 06.10.2023











